Artikel von Heiko Bär für das Amtsblatt vom 09.11.2019
Als SPD-Fraktion gehen wir mit dem Thema Klimaschutz besonnen, sachlich und unaufgeregt um. Neben dem Erkennen von lokalem, klimapolitischem Handlungsbedarf gehört die Berücksichtigung und Abwägung der Folgewirkungen für alle in der Stadt arbeitenden und lebenden Menschen und Generationen dazu. Klimaschutz und Anpassung an Klimaveränderungen ist ein immer wichtigeres politisches Aufgabenfeld. Dieses muss dann innerhalb der demokratischen Spielregeln mit den anderen politischen Anliegen abgewogen werden und steht nicht jenseits davon. Entsprechend sollten im Zentrum der Diskussion auch keine Schlagwörter, sondern konkrete Maßnahmen und Handlungen stehen.
Wir begrüßen darum, dass Ende Oktober vom Stadtrat die Erstellung eines Pakets an kurz-, mittel- und langfristigen lokalen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beschlossen wurde. Ein erster Baustein soll Ende kommenden Jahres vorliegen. Dass trotz zugespitzter Auseinandersetzung um den Begriff „Klimanotstand“ auch achtsame Entscheidungen getroffen werden können, zeigt die unmittelbar folgende Abstimmung zur Fernwärme aus Lippendorf. Hier standen für uns und die Stadtratsmehrheit letztlich die Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit der Fernwärme genauso im Fokus, wie der perspektivische Ausstieg aus dem Vertrag.



 Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
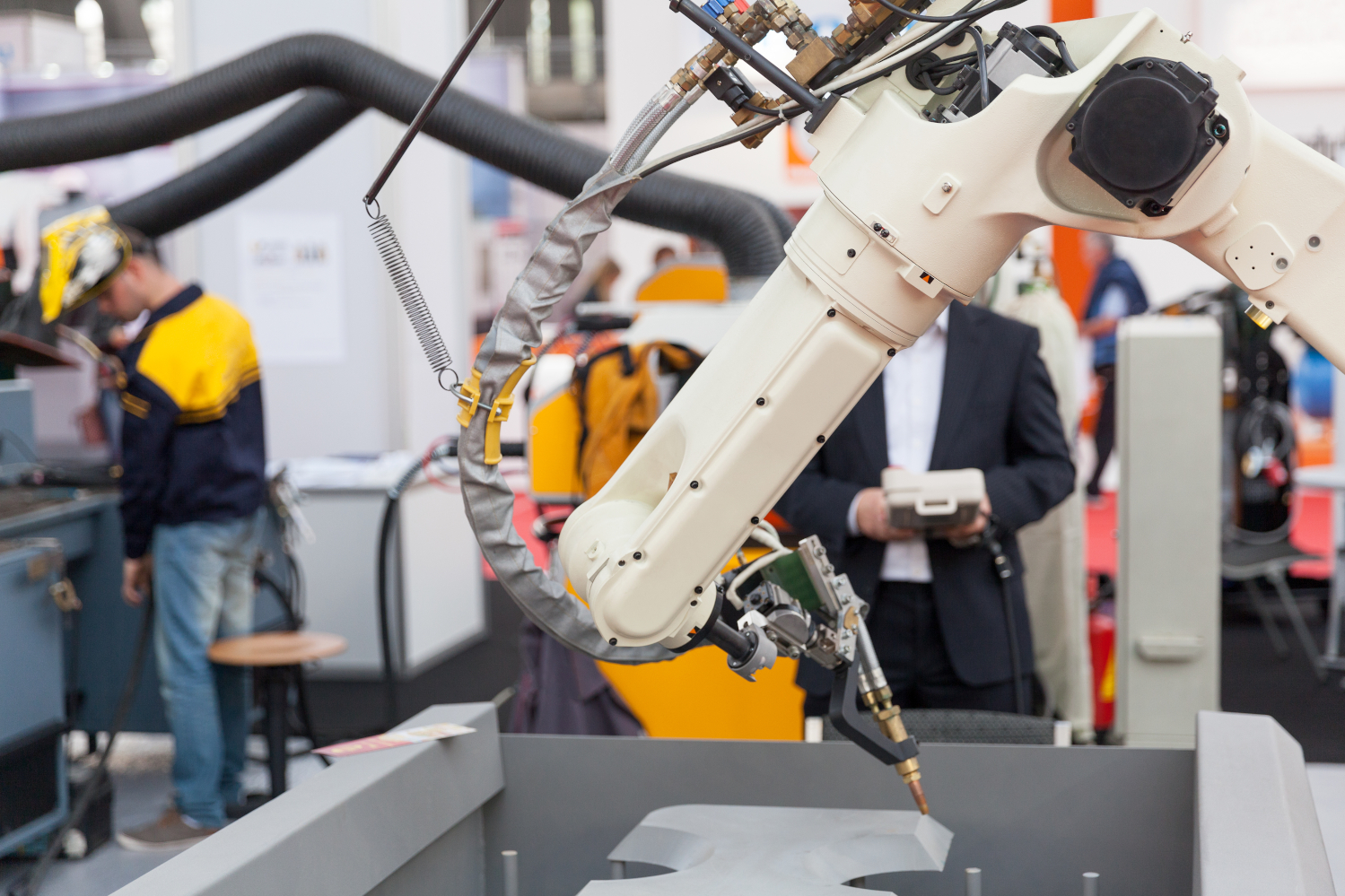
 Die Leipziger SPD-Fraktion möchte, dass sich die Stadt Leipzig ab dem kommenden Jahr an der Aktion „Einheitsbuddeln“ beteiligt. Diese Aktion wurde von Land Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Jährlich am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, soll mit Baumpflanzaktionen sowohl an die Überwindung der deutschen Teilung erinnert als auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.
Die Leipziger SPD-Fraktion möchte, dass sich die Stadt Leipzig ab dem kommenden Jahr an der Aktion „Einheitsbuddeln“ beteiligt. Diese Aktion wurde von Land Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Jährlich am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, soll mit Baumpflanzaktionen sowohl an die Überwindung der deutschen Teilung erinnert als auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.
 „Dieser Schritt ist ein wichtiges Signal an die Belegschaft der LVB, dass für gleiche Arbeit endlich auch wieder gleiche Löhne gezahlt werden. Das begrüßen wir sehr“, erklärt SPD-Fraktionschef Christopher Zenker äußerst zufrieden in einer ersten Reaktion auf das Tarifergebnis. „Die Verkehrsbetriebe stehen vor großen Herausforderungen. Die Verkehrswende hin zu einem attraktiven ÖPNV kann nur mit hoch motivierten und zufriedenen Mitarbeitern gelingen. Diese Tarifangleichung wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, so Zenker weiter.
„Dieser Schritt ist ein wichtiges Signal an die Belegschaft der LVB, dass für gleiche Arbeit endlich auch wieder gleiche Löhne gezahlt werden. Das begrüßen wir sehr“, erklärt SPD-Fraktionschef Christopher Zenker äußerst zufrieden in einer ersten Reaktion auf das Tarifergebnis. „Die Verkehrsbetriebe stehen vor großen Herausforderungen. Die Verkehrswende hin zu einem attraktiven ÖPNV kann nur mit hoch motivierten und zufriedenen Mitarbeitern gelingen. Diese Tarifangleichung wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, so Zenker weiter. „Obwohl auf die Verkehrsbetriebe deutlich höhere Personalaufwendungen zukommen, wird letztendlich auch das städtische Unternehmen profitieren“, sagt Heiko Oßwald, der die SPD im Aufsichtsrat der LVV vertritt. „Die LVB hatten im zurückliegenden Jahr massive Probleme, ausreichend Fahrpersonal zu finden. Das führte zu Fahrplanausfällen und weniger Fahrgästen. Mit fairen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen wird es zukünftig einfacher werden, ausreichend gut qualifiziertes Personal zu finden“, so Oßwald weiter.
„Obwohl auf die Verkehrsbetriebe deutlich höhere Personalaufwendungen zukommen, wird letztendlich auch das städtische Unternehmen profitieren“, sagt Heiko Oßwald, der die SPD im Aufsichtsrat der LVV vertritt. „Die LVB hatten im zurückliegenden Jahr massive Probleme, ausreichend Fahrpersonal zu finden. Das führte zu Fahrplanausfällen und weniger Fahrgästen. Mit fairen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen wird es zukünftig einfacher werden, ausreichend gut qualifiziertes Personal zu finden“, so Oßwald weiter.