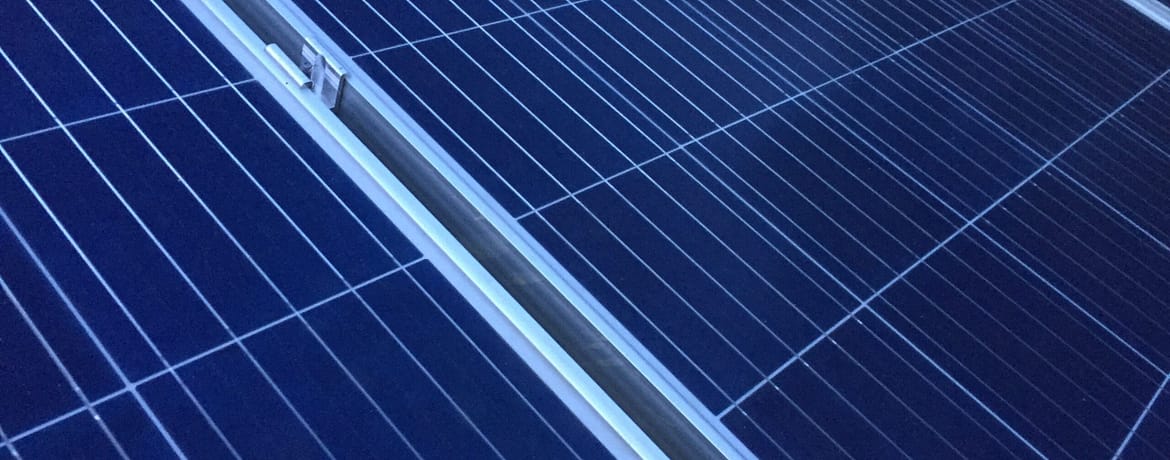Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung verankern
Beschlussvorschlag Der Beschlussvorschlag wird um folgenden Beschlusspunkt ergänzt: Die Erstellung quartiersbezogener Klimawandelanpassungskonzepte beinhaltet auch die Betrachtung wassersensibler Aspekte im Vorhabengebiet. Die Niederschlagsbewirtschaftung und damit verbundene Festsetzungen sollen sich am Ziel der Abbildung des natürlicherweise vorhandenen Gebietswasserhaushaltes und dessen Hauptkomponenten Verdunstung, Versickerung und Abfluss orientieren. Dazu können auch Regenwassernutzungen beispielsweise für die Bewässerung von Pflanzen zählen, […]